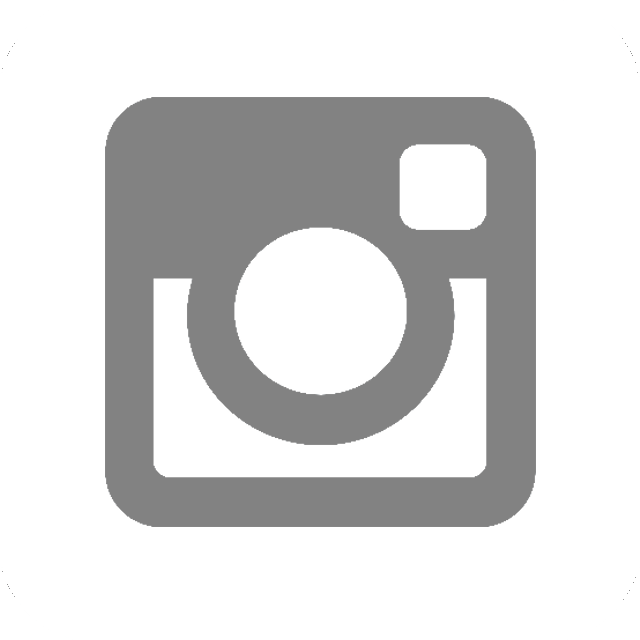Taube, Liebe, Hoffnung – was ich von 1500 Vögeln über Heimat gelernt habe
Mirko schlägt die Fahrertür hinter sich zu, ein Knall, ein Flattern. Auf einem Berg im Sauerland dreht er sich die sechste Zigarette des Tages. Neben ihm parkt ein Lastwagen, in dem 1500 Tauben warten. Mirko schaut auf sein Handy – 9 Uhr und immer noch kein Anruf von Thomas. Er schaut in die Sonne, von der er sagt, dass sie „am aufgehen“ ist. Zu den Tauben schaut er nicht. Mirko interessiert sich nicht für Tauben. Endlich klingelt sein Handy.

„Nebel über Lüdenscheid“, sagt Thomas. Er will in einer Stunde nochmal anrufen. Mirko legt auf, schaut wieder in die Sonne. Um ihn herum: viel nichts, nur ein paar Ponys und eine schmale Straße. Als er gestern Nacht hier angekommen ist, vor dem Lastwagen seine Zähne geputzt hat und sich dann schlafen legte, war es dunkel. Jetzt ist es Idylle. Thomas bezahlt ihn pro Stunde.
70 Kilometer Luftlinie entfernt von Mirko beobachtet Thomas den Nebel über Lüdenscheid auf einer Wetterkarte. Er ist seit drei Stunden wach, das macht neun Zigaretten. Thomas ist Flugleiter der Reisevereinigung Witten, einem Club von Brieftauben-Züchtern im Ruhrgebiet.
Heute, an einem Sonntag im April, fliegen die Tauben zum ersten Mal, nachdem sie den Winter im Schlag verbracht haben. Die Vögel, die mit Mirko im Lastwagen auf dem Berg warten, sollen für die Wettflüge im Sommer trainieren. Bei diesen Flügen werden sie weggefahren, 70, 100, 600 Kilometer weit weg, um zurückzufliegen. Die schnellste Taube gewinnt. Thomas entscheidet, wann sie abheben dürfen.
Im Ruhrgebiet ist Taubenzucht ein Sport. Bevor der Sport vor über hundert Jahren erfunden wurde, waren die Tauben nichts als Vieh, das man essen konnte. Tauben legen viele Eier in sehr kurzer Zeit, die Küken sind nach 30 Tagen so groß wie ihre Eltern. Bergmänner haben mit den Wettkämpfen begonnen, weil Taubensport das Gegenteil von untertage ist: Sie wollten in den Himmel gucken anstatt in den Schacht.
Früher stand in jedem zweiten Garten zwischen Hamm und Duisburg ein Taubenschlag. Heute haben die Vereine Probleme, die Lastwagen zu füllen, weil kaum noch jemand züchtet. Das Ruhrgebiet hat längst verloren, was früher seine Identität war: Die Maloche, die Schlote, die Kohle. Wo früher Stahlwerke waren, sind heute künstlich angelegte Seen. Was bleibt, sind die Taubenzüchter, organisiert in ein paar Dutzend Vereinen.

Thomas teilt sich die Arbeit mit einem Freund. Zusammen sind sie eine „Schlaggemeinschaft“ und haben 120 Tauben, die in einem Schrebergarten zwischen Witten und Bochum wohnen. Die beiden teilen die Futterkosten, das Geld für den Tierarzt und das Gartenhäuschen, in dem Pokale neben Ramazotti-Flaschen stehen und Urkunden an der Holzvertäfelung hängen. So viele Urkunden, dass sie die unwichtigen in einem Umzugskarton stapeln.
Thomas öffnet eine Holzkiste, aus der es nach Früchten riecht und nach Feuchtigkeit. „Das bekommen die Tauben vor der Reise“, sagt er und schüttelt eine alte Plastikflasche, gefüllt mit einer roten Flüssigkeit, in der Stückchen schwimmen. „Haben wir selbst gemischt. Mit Beeren und Quinoa.“ Wer im Taubensport etwas erreichen will, muss mehr tun als nur füttern und fliegenlassen. 120 Tauben kosten etwa 3600 Euro im Jahr. Taubenzüchten ist ein Hobby für Menschen, die es sich leisten können, einen Lastwagen-Fahrer zu bezahlen.
Mirko hat nichts zum Lesen mitgenommen. Er dachte, später als 9 Uhr wird es nicht. Mit zusammengekniffenen Augen scrollt er durch die Nachrichten auf seinem Handy, sein Facebook-Profilbild zeigt einen Zechenturm im Sonnenuntergang. Unter der Woche fährt er Lastwagen für eine Spedition, am Wochenende fährt er Vögel. „Is‘ natürlich Kultur im Ruhrgebiet, mit die Tauben. Aber ich hätte da keine Zeit für.“ Den Job macht er, weil es ein Job ist. Und weil er dabei seine Ruhe hat. Das sagt er oft, während er rauchend vor dem Lastwagen steht: „Ich will einfach nur meine Ruhe haben.“
Eigentlich wollen auch die Tauben ihre Ruhe. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie keine weiten Strecken fliegen, sondern lieber über ihrem Schlag kreisen und ab und an ein Ei legen. Damit sie sich auf dem Weg nach Hause besonders beeilen, bleiben ihre Küken im Schlag. Im Lastwagen sitzen Männchen und Weibchen getrennt voneinander, sodass die Tauben denken, ihr Partner warte zuhause auf sie.
Manche Tierschützer sagen, Taubenzucht sei Tierquälerei: Der Lastwagen erinnert an eine Legebatterie auf Rädern. Die Tauben sitzen übereinandergestapelt in Fächern. Davor schläft Mirko, 1,90 Meter groß, in einer Fahrerkabine, in der er sich geradeso umdrehen kann. Aber wenn Mirko und die Tauben nicht wegfahren, können Thomas und die anderen Züchter nicht in den Himmel gucken.
Taubensport ist komplexer als ein Kegelclub. Zwischen April und September ist jedes Wochenende Taubenwochenende. Dann verbringen Thomas und sein Schlag-Partner viel Zeit miteinander. Samstagnachmittag ist „Einsetzen“. Die Tauben kommen aus dem Schlag in eine Kiste und aus der Kiste in den Lastwagen. Thomas steht vor dem Schlag, streicht über Federn, zählt, wie viele Vögel in welcher Kiste sitzen. Samstagabend ist Abfahrt. Die Züchter gehen früh ins Bett. Sonntag gibt Thomas den Startbefehl. Dann sitzt er in seinem Schrebergarten und wartet darauf, dass die erste Taube am Himmel auftaucht.

In der Saison können die Züchter keinen Urlaub machen, nicht mal eine Gartenparty bis in die Nacht. Hinter jedem Mann mit Tauben steht deshalb eine Frau, der die Tauben egal sind. „Die waren vor mir da. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse“, sagt eine Ehefrau, während ihr Mann zwei Kisten voller Tauben durchs Vereinsheim trägt.
Ein anderer Züchter sagt: „Tauben oder Familie. Beides geht nicht.“ Seine eigenen Tiere hat er im Mofa-Anhänger zum Vereinsheim gebracht. Seine Haut ist grellrosa vom Fahrtwind. „Vielleicht höre ich demnächst auf mit dem Scheiß“, sagt er. „Mutter is‘ krank.“
Es ist warm geworden auf dem Berg im Sauerland. Mirko wirft seine Winterjacke mit dem MAN-Logo auf den Beifahrersitz. Er trägt ein braunes Shirt, auf seinem Unterarm ist ein Schriftzug tätowiert: Ruhrpott in schwarzer Fraktur. „Ich leb‘ schon immer hier. Werd‘ hier wohl auch sterben“, sagt der 35-Jährige.
Tauben sind standorttreu. Man wird sie nicht los. Man kann sie jahrelang in einen anderen Schlag sperren – sobald sie frei sind, fliegen sie wieder nach Hause. Keiner weiß, warum sie das können; Biologen vermuten, dass sie sich am Sonnenstand und an Magnetfeldern orientieren. Als ein Dortmunder Züchter, mehrfach Deutscher Meister im Brieftaubensport, seinen Schlag aufgeben musste, um seine kranke Frau zu pflegen, konnte er die Tauben nicht an andere Züchter verkaufen. Sie wären zu ihm zurückgekommen. Am Ende drehte er jedem Tier eigenhändig den Hals um.

Um 11 Uhr ruft Thomas endlich wieder an. Mirko ist sicher: Jetzt geht es los. Tatsächlich ist der Nebel über Lüdenscheid verschwunden. Aber der Lastwagen einer anderen Reisevereinigung steht nur ein paar Kilometer weiter weg. „Wir warten noch, sonst kommen sich die Schwärme in die Quere“, sagt Thomas. „Kannste nix machen“, sagt Mirko und steckt das Handy zurück in die Hosentasche. „Ist schon besser, wenn die sich das gut überlegen“, sagt er dann. „Am Ende bin ich sonst der Gelackmeierte. Wenn denen ihre Tauben nicht richtig fliegen, dann ist der Fahrer schuld.“
Taubenzüchter sind Rivalen. Wer mehrere Stunden am Tag damit verbringt, Taubenkacke von Holzböden zu kratzen, wer Kraftfutter mischt und mit Küken zum Tierarzt fährt, der will auch gewinnen. Obwohl es bei den Wettflügen kein Preisgeld gibt, nur Pokale und Urkunden.
Das älteste Mitglied in Witten ist 90 Jahre alt, seit 74 Jahren Taubenzüchter. Mit den Armen geht noch alles, die Beine zittern bei jedem Schritt. „Wenn ich jemanden hätte, der mir hilft, dann könnte ich noch weitermachen“, sagt er, während er Taube für Taube durch eine Klappe in den Lastwagen schiebt. Sein Schwiegersohn ist letztes Jahr gestorben. Jetzt ist da keiner mehr.
„Die besten Tauben sind Einzelkämpfer. So wie die hier“, sagt Thomas und streichelt mit seinem Zeigefinger über den Bauch der Taube mit dem Fußring Nummer 134. „Die fliegt vorneweg.“ Nummer 134 braucht keinen Windschatten, sie findet alleine nach Hause.
Mirko hat bis jetzt einen Schokoriegel und eine Flasche Cola gefrühstückt. Es ist 12 Uhr und Thomas ist am Telefon: „Kannst auflassen“, sagt er. Endlich.
30 Sekunden später zieht Mirko an einer Leine, mit der er alle Boxen des Lastwagens öffnet.

Der Moment, in dem 1500 Tauben gleichzeitig abheben, fühlt sich an wie eine Windmaschine, klingt wie raschelndes Seidenpapier und sieht aus wie Ballett. Der Schwarm formiert sich, fliegt eine Schleife und dreht dann um, Richtung Südosten. Richtung Witten. Die Züchter interessiert dieser Moment nicht, Thomas war erst ein Mal dabei.
Der Wind steht gut für Taube Nummer 134. Sie fliegt über Berge, Felder, Autobahnkreuze, fliegt, weil sie Hunger hat, fliegt, um anzukommen, fliegt 70 Kilometer in einer halben Stunde. Und landet. Landet auf dem großen Trampolin, das in Thomas‘ Schrebergarten steht. Ein Trampolin, wie Kinder es sich zu Weihnachten wünschen, größer als zwei Doppelbetten. „Das hatte ich mal für meine Kinder gekauft, als die noch klein waren. Aber die kommen nicht mehr her, die interessieren sich auch nicht für Tauben“, sagt er.
Wenn die Züchter mit Bierflaschen in der Hand im Vereinsheim stehen und sich unterhalten, geht es viel um ihr Hobby und genau so viel um den Verfall ihres Hobbys. „Sophie studiert jetzt auf Mallorca, Dominik ist in die Lehre gegangen und Beates Vater hat Parkinson“ – Thomas sagt das am Samstagabend immer wieder, immer in dieser Reihenfolge. Immer als Antwort auf die Frage, wann die Preisflüge endlich fertig vorbereitet sind. Sophie und Dominik haben ihm früher bei der Verwaltung geholfen und ein Taschengeld dafür bekommen. Mit Beate ist er zusammen. Jetzt ist er Einzelkämpfer. Jugendliche gibt es im Verein nicht, junge Menschen kaum. Weil die Mitglieder wegsterben, schließen sich manche Vereine zusammen, um die Kosten zu teilen.
„Die Jugendlichen haben andere Sachen“, sagt Thomas. „Smartphone, Disco, Auto.“ Das ist das Bermudadreieck, in dem die Taubenzüchter ihren Nachwuchs verlieren. Die Jungen gucken lieber auf Displays als in den Himmel. Auf den Displays ist die ganze Welt, am Himmel sind nur Tauben. Am Wochenende schlafen sie lieber aus, anstatt am Schlag zu warten auf die Vögel, deren Dreck man wegwischen muss. Mit ihrem Auto fahren sie davon, an Orte, an denen es egal ist, wer wie schnell nach Hause kommt.

Als Nummer 134 längst in ihrem Nest sitzt, steht Mirko im Stau auf der A44 zwischen Autos, in denen Menschen Sonntagsausflüge machen. Er ist der einzige Fahrer, der dem Wittener Taubenverein geblieben ist. Bald wird er in der Spedition befördert, gerade holt er an der Abendschule die Ausbildung nach. Ob er dann noch jedes Wochenende Tauben durch die Gegend fährt, weiß er nicht. Wenn er erst mal Chef ist, will Mirko ein Haus am Stadtrand kaufen. Nur seine achtjährige Tochter muss er davon noch überzeugen: Sie will am liebsten in der Mietwohnung bleiben, in der sie aufgewachsen ist. Wegziehen, das kann sie sich nicht vorstellen.